Dieter Nuhr: Nur Spaßmacher oder auch Politiker?
Wie man durch Humor noch effektiver neoliberale Gehirnwäsche betreibt
Die einen gehen in die Universität und die anderen gehen noch mit Vollbart in die 4. Klasse, nur weil sie 1 und 1 nicht zusammenzählen können. Das ist ja nicht gerecht.
Gerechtigkeit ist, wenn man auch als Analphabet schreiben kann, nur eben anders. Und wenn jeder Weltmeister werden darf. Warum denn nicht? Man muß nur knapp 7 Milliarden Goldmedaillen pressen und dann kann jeder die 100 Meter in 9,58 laufen, oder in 1:25 Minuten oder in 2:65 Stunden. Ist ja dann wurscht, wenn alles gerecht ist.
Das Thema dieser Passage ist die (soziale) Gerechtigkeit. Nuhr versucht zu begründen, weshalb es keine Gerechtigkeit geben könne. Er versucht dies zunächst anhand von Beispielen zu verdeutlichen. Nicht alle Menschen könnten auch alle Berufe (insbesondere die hoch angesehenen) ergreifen. Diese Aussage erscheint unsinnig, da seine Beispiele nichts mit tatsächlich stattfindenden Diskussionen rund um soziale Gerechtigkeit zu tun haben. Möchte man nun dennoch darauf eingehen, sei angemerkt, daß Nuhr die hohe Bedeutung der Bildung mit dieser Aussage vernachlässigt. Schließlich sind nur wenige Menschen von Natur aus „bekloppt“ oder unfähig. Die meisten können sich durch gute Erziehung und freiheitliche, persönlichkeitsorientierte Bildung sehr weit in sehr unterschiedlichen Bereichen entwickeln.
Nuhr verwendet den Begriff der Gerechtigkeit hier sehr ungenau; im Kontext von Bildungssystem und Berufswahl wird in der Regel ein etwas anderer Begriff, nämlich der der Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit, verwendet. Kein Linker und keine Sozialdemokratin würden je fordern, daß Menschen, die offensichtlich ungeeignet sind, aus Gerechtigkeitsgründen einen bestimmten Beruf ergreifen sollten. Ausgerechnet am Beispiel des Pilotenberufs versucht Nuhr zu demonstrieren, weshalb nicht jeder Mensch einen beliebigen Beruf ergreifen könne. Der Pilotenberuf gehört zu den wenigen Berufen, bei welchen tatsächlich extrem hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Körper, Geist und Sinnen gestellt werden. Damit ist dieses Beispiel wenig aussagekräftig.
Nuhr verwendet den Gerechtigkeitsbegriff damit bewußt falsch und verspottet die Forderung und das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit im Bildungssystem.
Was mach ich mit einem Handy? Ja, das ist das Entscheidende, das ist das Quälende. Das ist das Problem in der Demokratie. In der DDR gab's keine Handys, nicht mal Klingeltöne – es war nicht alles schlecht. […]
„Zu fett, zu alt, zu doof“. Wer in diese Kategorien gehöre, habe auch keinen Anspruch auf „eine Sprintmedaille“ – diese Medaille steht hier wohl metaphorisch für die Auszeichnung individueller Leistung. Sie kann im Zusammenhang mit dem Thema sozio-gesellschaftlicher Chancengerechtigkeit etwa für einen Schul- oder Studienabschluß stehen. Etwa für ein Abitur, das die „Dummen“ dementsprechend nicht erreichen dürften oder für einen Universitäts-Master, den vielleicht nicht jeder Bachelor-Absolvent bekommen dürfe. „Zu doof“? „Zu alt“? „Zu fett“?
In der zweiten Hälfte dieser Passage holt Nuhr dann den Holzhammer heraus und wendet das Totschlagargument Kommunismus an. Durch die Aneinanderreihung der Themen soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit im ersten Teil der Passage und der Themen Kuba und Kommunismus im zweiten Teil setzt er sie absurderweise quasi gleich. Noch unpassender ist die Quasi-Gleichsetzung Oskar Lafontaines (linker Sozialdemokrat aus der Linkspartei) mit Kuba und der DDR (hier gemeint als Synonyme für veraltet, kommunistisch, totalitär) durch die Nennung in einem Satz. Seinen Andeutungen zufolge würden auf Kuba „die Doofen“ zu Universitätsprofessoren ernannt, die „zu Alten“ zu Piloten und die „zu Fetten“ zu Sprintweltmeistern, was natürlich unsinnig ist. Natürlich fordert so etwas auch kein Lafontaine für die Bundesrepublik Deutschland. Diese „Argumente“ gehen somit an allen realen, mit dem Thema Gerechtigkeit in Zusammenhang stehenden Aspekten komplett vorbei. Nuhr weiß offenbar nicht, welches die Themen sind, die in gesellschaftlichen Diskursen um soziale Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit eine Rolle spielen. Oder er ignoriert die wirklichen Themen und ersetzt sie durch Pseudo-Themen, da er dadurch besser seine Meinung verbreiten kann.
Wir haben in sofern einen gesunden Ausgleich: Alle sind beleidigt.
Um trotz der geballten „sozialen Kälte“ dieser Aussagen beim eigenen Publikum nicht in Ungnade zu fallen, dreht Nuhr gegen Ende etwas ab, indem er damit abschließt, die Existenz des Sozialstaats sei ja begrüßenswert („ist ja auch toll“).1 Das zuvor Gesagte wird damit scheinbar relativiert, jedoch nicht aufgehoben, und wirkt für sich weiter. Der Schlußsatz ist aber in der BRD typisch für neoliberale Akteure. So würden trotz gegenteiliger politischer Bemühungen nicht einmal die Bertelsmann-Stiftung oder der FDP-Chef öffentlich die Existenz eines starken Sozialstaates in Frage stellen, da die allgemeine (zumindest verbale) sozialdemokratische Deutungshoheit dies nicht zuließe.
Auch hier geht Nuhr erneut dazu über, den Begriff der (sozialen) Gerechtigkeit zu verhöhnen. Er sagt, alle Statusgruppen der Gesellschaft hätten nur ihre jeweils eigenen Interessen im Fokus. In dieser Aussage schwingt die Behauptung mit, die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit sei in Wirklichkeit von Egoismus geleitet, weil man sich eine Umverteilung zu den eigenen Gunsten erhoffe. Diese Behauptung ist jedoch offensichtlich sehr häufig falsch. So ist der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit in der Regel als Altruismus zu werten und schallt aus allen Gesellschaftsschichten, vor allem aus der finanziell recht gut abgesicherten Mittelschicht. Beste Beispiele sind etwa die studentischen Proteste für eine soziale Öffnung des Bildungssystems. Die vermeintliche Forderung nach Gerechtigkeit mit dem Ziel der eigenen Bereicherung gibt es hingegen eher nicht. Kein Banker oder Wirtschaftsboss würde auf die Idee kommen, mit Hinweis auf die soziale Gerechtigkeit eine Steuersenkung für Vielverdiener zu fordern!
Nuhr bezieht sich vermutlich auf die Theorien rund um den Homo oeconomicus, nach denen Menschen angeblich stets nutzenmaximiert handelten. Tatsächlich ist aber häufig zu beobachten, daß sich Menschen für bestimmte Politiken und Gesellschaftsstrukturen einsetzen, obwohl sie wissen, daß dies mit finanziellen Nachteilen für sie und ihre Gesellschaftsschicht verbunden ist.
Nuhr erhebt sich mit behäbiger Arroganz über die „Schwachen“ und Mittellosen und über diejenigen, die Maßnahmen gegen soziale Unterschiede ergreifen. Ob die Art und Weise, in der er dies tut, nun als gelungener Humor angesehen wird, hängt wohl nicht zuletzt davon ab, ob die tiefere Bedeutung seiner scheinbar oberflächlichen Aussagen richtig verstanden wird. Die Ansichten Nuhrs sind opportunistisch und muten als Mischung aus neoliberaler Ideologie und unpolitischer Mehrheitsmeinung an. An einigen Stellen scheint zudem mangelndes Detailwissen über politische Prozesse und Institutionen Grund für eine inhaltlich unpräzise und in sich unlogische Argumentation zu sein. So bleibt die Treffsicherheit seiner Analyseversuche gering.
Eine derartige Verbreitung von Unkenntnis und Halbwissen trägt zur allgemeinen Verwirrung bei und bewirkt, daß wenig kritische Menschen in Nuhrs politischem Sinn manipuliert werden – vermutlich ohne es selbst zu bemerken. Nichtsdestoweniger ist Nuhr nicht zufällig erfolgreich. Er vertritt nichtfundiert-populäre, vom neoliberalen Zeitgeist dominierte Meinungen auf exemplarische Art und Weise und präsentiert diese im Rahmen seines „Humorprogramms“ in einem Ton anbiedernder Kumpelhaftigkeit. Seine Ideologie der sozialen Ungerechtigkeit verbreitet er so vermutlich effektiver als so mancher dafür bezahlte Lobbyist.
Quelle des Artikels ist das folgende Buch:
|
|||
1 Möglicherweise definiert sich Nuhr selber gar nicht als Neoliberaler, sondern als pragmatischer Sozialdemokrat nach dem Typus eines Gerhard Schröders, dem gar nicht bewußt zu sein scheint, daß die eigenen Forderungen von vielen gar nicht als sozialdemokratisch erachtet werden.

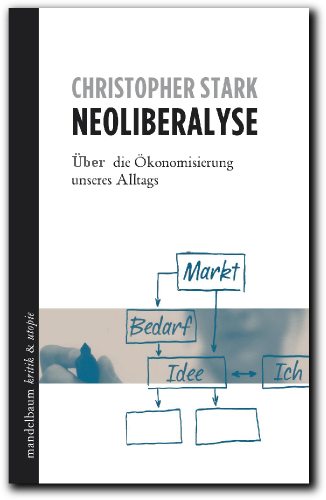


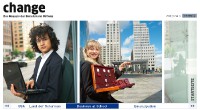

Nuhr ist komisch -da ist schon mal ein Pluspunkt. Wenn er über die Bibel herzieht, bei der Story mit Adam und Eva nach Quellenangaben fragt, lacht man schon (als Christ über sich selbst) mit. Doch bereits, wenn er dann zur Kritik am Moslem ausholt, weit ausufernder, dann wirds irgendwie etwas (ethno-) rassistisch. Da plappert er munter die neuesten Propaganda-Schlagwörter nach, gegen Putin selbstredend auch -ohne Quellenkritik. Seine Prügel für die Linken ist reichlich einseitig, denn die Rechten mit ihren Ideologien (Neoliberalismus, Sozialdarwinismus) trifft Nuhr nie -daraus kann man wohl schließen, dass er diese Weltanschauungen selbst vertritt. Oder dass er ein korrupter Gierhals ist, der gemerkt hat, dass er mit Linksbashing sehr leicht im Mediensystem Erfolg haben und absahnen kann. Warum ist erlustig? Vielleicht liegt es auch schlicht an seinem Gesicht, das blasierte Arroganz gut darstellen kann -die er seinen Satirezielen unterstellt, aber auch selbstironisch (?) zelebriert.